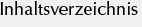1 Die Grundbausteine
1.1 Atome und Ionen
Wir sind ständig von einer riesigen Anzahl unterschiedlicher Substanzen
umgeben. Metalle wie Eisen, Kupfer, Zink, Chrom, Silber oder Gold sind
uns gut bekannt, wir begegnen Steinen aller Art in der Natur und in
unserem häuslichen Bereich: Es seien Gips und Marmor, Edelsteine
wie Saphir und Diamant genannt. Mit Kohle und Öl wird geheizt,
Luft und Wasser sind für uns lebensnotwendig, unsere Speisen bereiten
wir mit Zucker und Salz: Substanzen über Substanzen, der Chemiker
nennt sie auch "Stoffe".
Alle Substanzen sind nun aus unzählig vielen kleinsten Teilchen
zusammengesetzt, die man sich als kugelige Bausteine vorstellt. Sie
sind so klein, daß wir sie einzeln mit unseren Sinnesorganen
nicht wahrnehmen können. Allerdings lassen viele Eigenschaften
und Umwandlungen der Substanzen, die wir später noch kennenlernen
werden, auf diese Teilchen schließen. Untersucht man viele Substanzen
experimentell bezüglich ihrer Bausteine, dann erhält man
zwei, in ihren Qualitäten unterschiedliche Arten kleinster Teilchen.
Sie unterscheiden sich in der Weise, daß sie auf "Kraftsender" verschieden
reagieren.
Machen wir uns diese Sachlage zunächst an ähnlichen Beispielen
klar: Jeder kennt einen Magneten und seine Eigenschaft. Nähert
man dem Magneten ein Stück Eisen, dann macht sich eine Kraft bemerkbar,
die das Eisen in seine Richtung anzieht. Die Metalle Kobalt und Nickel
verhalten sich ebenso wie Eisen. Andere Metalle wie Aluminium, Kupfer
oder Blei, andere Stoffe wie Holz oder Kochsalz reagieren auf das geheimnisvolle
Anziehungsangebot des Magneten nicht. Offensichtlich hat der Magnet
die Fähigkeit, auf eine besondere Eigenschaft des Eisens, Kobalts
und Nickels zu antworten. Zu einer Kraftfernwirkung, etwa zu der eines
Magneten, gehören demnach zwei Dinge: Zum einen muß ein "Kraftsender" mit
der Fähigkeit der Kraftwirkung gegeben sein, zum anderen muß das
Material, auf das die Kraft wirken soll, die Eigenschaft des Wahrnehmens
dieser Fähigkeit besitzen. Den räumlichen Bereich, in dem
eine Kraftwirkung spürbar ist, bezeichnet der Physiker als "Feld".
Ein Magnet besitzt um sich herum ein Magnetfeld.
Völlig analog verhält es sich bei der Massenanziehung. Die
sehr große Masse der Erde sendet spürbar Kraftfernwirkungen
aus und andere Materie besitzt die Eigenschaft des Wahrnehmens. Wir
spüren die sich ergebenden Kraftwirkungen als Schwerkraft an allen
materiellen Dingen: alle Gegenstände fallen nach unten in Richtung
der Erde. Der Physiker bezeichnet den Raum um die Erde, in dem die
Materiekraftwirkungen spürbar werden, als Schwerefeld, als Gravitationsfeld.
Schwerkraft und Materie gehören also zusammen wie Magnetkraft
und Eisen.
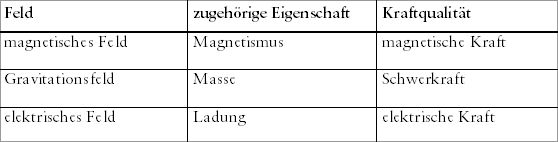
Tab.1.1: Verschiedene Kraftfelder, Eigenschaften
und Kraftwirkungen
Eine dritte, nahezu alltägliche Erscheinung stellt das elektrische
Kraftfeld dar: Beim Kämmen frisch gewaschener, trockener Haare
beobachtet man bläuliche Funken, beim Gehen auf einem Kunststoffboden
lädt man sich elektrisch auf, Plastikfolien und Papier "kleben" aneinander.
Eine mit Papier geriebene Plastikfolie besitzt demnach die Fähigkeit
der Kraftwirkung, ein elektrisches Feld. Dieses wirkt auf ein in die
Nähe gebrachtes Papier und zieht das Papier stark an. Das Papier
muß eine besondere Eigenschaft aufweisen, um auf das elektrische
Feld der Folie "antworten" zu können: Diese Eigenschaft
wird elektrische Ladung genannt. Die zusammengehörenden Begriffspaare
sind in Tabelle 1.1 noch einmal nebeneinander gestellt.
Wenn wir uns nun diese drei verschiedenen Kraftfelder erzeugen und
uns vorstellen, jeweils ein kleines Testkügelchen in das Kraftfeld,
den Kräftebereich hineinzuhalten, so können wir prüfen,
ob das kleine Kügelchen eine der Eigenschaften, die zu den Kraftfeldern
gehören, besitzt Wenn die Eigenschaft vorhanden ist, muß eine
Kraftwirkung auftreten, wenn keine Wirkung auftritt, besitzt das Kügelchen
die Eigenschaft nicht.
Auf diese Art und Weise prüfen wir jetzt die Bausteinsorten unserer
Materialien. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:
1. Keines der vielen Teilchenarten reagiert primär auf ein Magnetfeld.
2. Alle Teilchenarten reagieren auf das Schwerefeld, sie besitzen also
eine Masse.
3. Ein großer Teil der Teilchen reagiert im elektrischen Feld,
sie besitzen elektrische Ladung.
4. Andere Teilchen reagieren im elektrischen Feld nicht, sie sind elektrisch
ungeladen.
Diese Unterscheidung der Teilchen in bezug auf ihre Kraftqualität
ist sehr wesentlich. Deshalb sind die Teilchenarten mit verschiedenen
Qualitäten auch unterschiedlich benannt worden.
Die ungeladenen Grundbausteine nennt man Atome. Die Grundbausteine
mit der Eigenschaft "elektrische Ladung" nennt man Ionen.
Die Atome besitzen selbstverständlich Kraftwirkungen untereinander,
Ionen üben ebenfalls Kraftwirkungen aufeinander aus, aber nicht
im gleichen Sinn. Dazu näheres an späterer Stelle (3.1.).
Das experimentelle Ergebnis der Physiker wollen wir mit einem Gedankenexperiment
erläutern. Wir greifen ein beliebiges Ion als "Test-Ion" heraus
und fixieren es an einer Stelle. Nun nehmen wir von unseren Substanzen
ein Ion nach dem anderen und bringen es langsam in die Nähe des
Test-Ions und beobachten die elektrische Kraftwirkung zwischen beiden.
Ein Teil der Ionen wird vom Test-Ion stark angezogen, ein anderer Teil
stark abgestoßen.
Diese unterschiedlichen Eigenschaften der Ionen kennzeichnet man mit
dem Plus-Zeichen "+" oder mit dem Minus-Zeichen "-".
Alle Ionen, die sich untereinander abstoßen und positiv gekennzeichnet
sind, werden als Kationen bezeichnet, diejenigen, die sich abstoßen
und negativ gekennzeichnet sind, als Anionen. Anionen und Kationen
sind demnach diejenigen Ionen, die sich gegenseitig anziehen.
Bei der Untersuchung der Substanzen sind nun sehr viele Bausteinsorten
gefunden worden. Es gibt z. B. Eisen-Atome, Kupfer-Atome, Chlor-Atome,
Schwefel-Atome und viele andere mehr. Gleichzeitig sind aber auch Eisen-Ionen,
Kupfer-Ionen, Chlor-Ionen und Schwefel-Ionen gefunden worden. Es mag
zunächst eigenartig erscheinen, daß die Chemiker Atome und
Ionen gleich benannt haben, z. B. Eisen-Atom und Eisen-Ion. Das hat
seinen Grund darin, daß zugehörige Atome und Ionen relativ
leicht ineinander umgewandelt werden können und insofern der gleichen
Teilchenfamilie zugeordnet sind. Das darf aber nicht über die
Tatsache hinwegtäuschen, daß ein Ion ganz andere Eigenschaften
besitzt als sein direkt verwandtes Atom, daß also ein Chlor-Atom
völlig andere Eigenschaften zeigt als ein Chlor-Ion.
Vielleicht können wir uns das an folgendem Beispiel verdeutlichen:
Ein Personenwagen, etwa ein BMW, hat eine ganz bestimmte Fahreigenschaft.
Wenn wir ein Rad abmontieren, dann ändert sich die Fahreigenschaft
völlig! Jeder wird aber das Fahrzeug noch sofort als BMW erkennen.
Der BMW-Charakter hat sich nicht geändert, dagegen sind die Fahreigenschaften
vollkommen anders. Bis zu welchem Punkt man also eine Sache abwandeln
kann und sie noch als dieselbe bezeichnet, ist eine alte philosophische
Frage. Sie wird uns noch häufig beim Beschreiben unserer Substanzen
begegnen.
Es bleibt jedenfalls festzustellen, daß die Eigenschaften von
Atomen und zugehörigen Ionen getrennt voneinander genau beobachtet
und ermittelt werden müssen. Man kann von den Eigenschaften eines
Atoms nicht auf die Eigenschaften des zugehörigen Ions schließen
und umgekehrt.
Unter natürlichen Bedingungen sind im allgemeinen die Ionen stabiler
als die zugehörigen Atome. Deshalb finden wir auch in der Natur
meistens die Ionen vor und nicht die Atome. Von 97 stabilen Grundbausteinsorten
findet man nur 17 als Atome (Edelmetalle, Edelgase!), alle anderen
80 Grundbausteinsorten kommen als Ionen vor. Eine Grundbausteinsorte,
also Atom und zugehöriges Ion, wird im allgemeinen als Element
bezeichnet. Die vielen Millionen natürlicher und künstlich
hergestellter Substanzen unserer Welt sind aus diesen wenigen Elementen
aufgebaut!
![]()